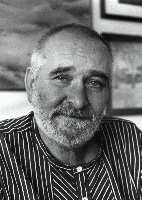
Bernd-Dieter Hüge
geboren:
9.5.1944
verstorben:
24.1.2000
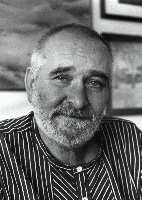 |
Bernd-Dieter Hüge |
||
|
geboren: |
9.5.1944 |
||
verstorben: |
24.1.2000 |
||
Das Sandschiff und andere Seltsamigkeiten, dreiteiliges Hörspiel, 1983, Berliner Rundfunk
Kaderakte eines Zugvogels - Gedichte von 1966 bis 1982, 1984, Berlin, Aufbau Verlag
Beichte vor dem Hund, Gedichte und Prosa, 1985, Berlin, Aufbau Verlag
Das Steinkind, Roman, 1989, Berlin, Aufbau Verlag (und 1995, Aufbau-Taschenbuchverlag)
Mein Knastbuch, Erzählbericht, 1991, Berlin, Aufbau Verlag (Reihe Texte zur Zeit)
Eine Textauswahl, Hallesche Autorenhefte Nr. 11, 1998, Förderkreis der Schriftsteller
Außerdem Veröffentlichungen von Lyrik in Zeitschriften und Anthologien.
Romane, Erzählungen, Hörspiel, Lyrik
Bernd-Dieter Hüges Prosadebüt „Das Steinkind“ ist der Lebensbericht einer ostpreußischen Familie, die nach 1945 infolge der Kriegswirren aus dem Kurländischen nach Schleswig-Holstein verschlagen wird. lm Mittelpunkt steht Jutaan Bernhard Lachgast, der in ruhelosen Jahren über Ländergrenzen hinweg schließlich bis ins Niederlausitzer Braunkohlenrevier kommt, in eine Landschaft voller Verletzungen. Erzählt wird, auf unterschiedlichen Ebenen, vom Leben dieses maurisch-gallischen Nachfahren. Dabei beweist der Autor Sinn für ganz reale Widersprüche und zugleich auch für jenen Zauber, der hervortritt, wenn Realität durch Imagination bewältigt wird.
(Neues Deutschland, 22.6.1990)
Um ein Uhr und fünf Minuten erreichten die Wehen ihren Gipfel, und die Austreibung begann. Mit freudigem Erschrecken und gelähmten Zungen sahen die Frauen
fünf winzige grünblaulila Spatzenfinger, die ihnen zuzuwinken schienen. Danach, die Hebamme hielt den Atem an, und Lotta-Lucia drückte die Hand aufs Herz, drang
eine zweite, ebengleich gefärbte faltenreiche Pfote heraus. Sie schien die erste zu schieben, so dass nicht lange darauf beide Hände und Arme hervorschauten, sich
jedoch in den Ellenbogen einknickten, zurückgriffen und zitternd zogen und zerrten. Die fassungslosen Frauen sahen das heftige Pulsieren der Bauchdecke, und sie
verfolgten in atemloser Unkenntnis einen Vorgang, welchen der Arzt, dem sie späterhin davon berichteten, als autoritäre Geburtshilfe bezeichnete. Die erfahrene, aber
unter dem Eindruck der Geschehnisse verwirrt staunende Hebamme sollte noch viele Jahre nach dem Krieg erzählen, dass diese Geburt vermutlich der Beweis dafür
wäre, dass Menschen nahewohl alles vermöchten, nämlich, sofern ihnen keiner ins Leben zu kommen hilft, sie sich ergo selbst gebären.
Mittlerweile hatten die Spürhände es geschafft, an sehr langen Haaren einen kümmerlichen Schädel hervorzuziehen, der, als er sich mit seinem Gesicht zu den Frauen
wendete, vom Ausdruck eines greisenhaften Zweifels gezeichnet war, voller enttäuschten Staunens in seinen leicht milchigen Augen. Als sie sich erholt hatten von der sie
heftig angreifenden Verblüffung, die sie lähmte und unfähig ließ, sich zu äußern über das, was sie sahen, erkannten sie in das trockene, seidenglänzende helle Haar eine
schwarze Stoffschleife eingebunden. Lotta-Lucia überwand ihre Fassungslosigkeit und rief aus: „Däm Beest häd Truer!“ Und sie blickte in die Augen ihrer
Tochter, die nunmehr keinerlei Schmerzen zu haben schien und mit einem Lächeln ihres sternenfaltig verzogenen Mundes kundgab, dass sie über alle messbaren
Schrecken des Universums hin erhaben und zufrieden wäre.
Sie machte auf die drei Frauen den Eindruck, dass sie um die Dinge, wie sie sich gerade taten, informiert wäre und glücklich über das, was sich tat in diesen niemals zu
wiederholenden Augenblicken ihres jungen Lebens.
Aus: „Das Steinkind“
In seinem „Knastbuch“ berichtet Hüge, was er als „Politischer“ in solch berüchtigten Haftanstalten wie Rüdersdorf, Bautzen und
Rummelsburg erlebt hat. Da ist allerdings nicht die Rede von den grauenhaften Vorfällen, die heute nach und nach an die Öffentlichkeit dringen, von Folter, Psychoterror
oder gar von Liquidationen. Hüge beschreibt hier vielmehr detailliert den Alltag im DDR-Strafvollzug, der in seinem unentrinnbaren Stumpfsinn so unentrinnbar war wie
das Leben außerhalb der Gefängnismauern.
(Hannoversche Allgemeine, 28.3.1992)
Die Tage und Stunden in der Untersuchungshaftanstalt Frankfurt vergingen mit dem morgendlichen Erwachen in der stickigen Luft der engen, überbelegten Zelle,
dem Zählappell, dem kargen Frühstück, dem beißenden Bohnerwachsgeruch und dem Zigarettenqualm in der kaum ausreichend gelüfteten Zelle. Nach einer Woche
wurde ich verlegt. Jetzt befand ich mich zusammen mit einem Häftling, der eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung zu erwarten hatte, und einem anderen,
der wegen verschiedener Einbruchsdiebstähle festgenommen worden war. Wir vertrugen uns ganz gut. Ich sammelte wieder Kippen aus den Blechdosen und drehte mir
unförmige und stinkende Tüten aus Zeitungen wie dem „Neuen Deutschland“ und dem „Neuen Tag“. Manchmal bekam ich etwas Tabak von
dem Einbrecher, und der Schläger gab mir Zigarettenpapier. Ich wunderte mich, woher die beiden den Tabak und das Papier hatten. Dann erfuhr ich, dass sie sich von
dem Kalfaktor, der das Essen ausgab, einmal in der Woche vom Einkauf Tabak und Papier mitbringen ließen. Sie sagten, dass sie Geld von zu Haus bekommen hätten.
An einem Vormittag Ende September holte mich ein Hauptwachtmeister aus der Zelle heraus. Er führte mich den halbdunklen Gang entlang und schloss eine Zelle auf, in
der niemand war. Er sagte zu mir: „Hier ist Ihre Anklageschrift. Sie müssen sie durchlesen und dann unterschreiben, alle Ausfertigungen. In einer Stunde hole ich
Sie wieder raus.“
Ich nahm mehrere eng beschriebene Blätter aus der Hand des Schließers entgegen. Der schloss die Tür, und ich stand eine Weile mit meiner Anklageschrift vor dem
fahlen Licht des mit einer rostigen Eisenblende versetzten Fensters. Das Original war ein Vordruck, die Durchschriften einfaches, dünnes grünliches Papier. Ich schaute
auf meinen Namen. Ich las das Wort „Angeklagter“, mein Geburtsdatum, den Ort meiner Geburt und meine Wohnanschrift. Im Kopf der Anklageschrift
stand „Kreisgericht Frankfurt an der Oder“. Ich las viele Male, ohne recht zu begreifen, dass ich jetzt ein Angeklagter sein sollte.
Aus: „Mein Knastbuch“